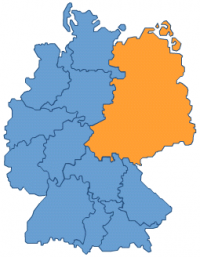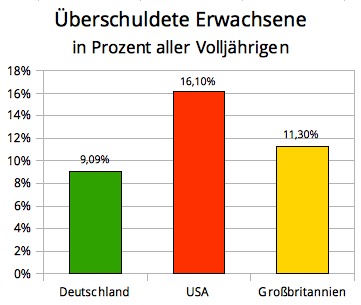Das P-Konto ab 2012
Im Juli 2010 startete das P-Konto. Mit Beginn des Jahres 2012 tritt die zweite Stufe der Einführung des Pfändungsschutzkontos in Kraft: Ab Januar gibt es den Pfändungsschutz nur noch mit P-Konto. Zu diesem Anlass finden Sie hier eine Übersicht zum Thema.
Pfändung
Bezahlt ein Schuldner seine Schulden nicht, können Gläubiger bei Gericht einen Pfändungsbeschluss erwirken. Gepfändet werden können verschiedene Dinge, beispielsweise Bargeld oder Gegenstände.
Gepfändete Gegenstände werden in der Regel versteigert – ihr Erlös wird dann zur Schuldentilgung eingesetzt. Viele Schuldner besitzen allerdings kaum Hab und Gut, das von Wert und pfändbar ist.
Kontopfändung
Gepfändet werden kann auch ein Bankkonto, zum Beispiel ein Girokonto. Auch hierfür bedarf es eines gerichtlichen Beschlusses. Eine Pfändung darf allerdings nicht dazu führen, dass ein Schuldner unter das Existenzminimum gedrückt wird.
Auch ein Schuldner besitzt Grundrechte. Diese nutzen im Übrigen nicht nur ihm selbst, sondern kommen auch dem Gläubiger zugute. Denn nur wessen Existenz gewährleistet bleibt, kann weiterhin Schulden begleichen.
Pfändungsfreier Betrag
Die Pfändungsfreigrenze gibt an, über welchen Geldbetrag ein Schuldner trotz Pfändung seines Kontos verfügen kann. Der Grundfreibetrag liegt derzeit bei monatlich 1028,89 Euro.
Der Wert wird allerdings regelmäßig an die sich ändernden Umstände angepasst. Steigen die Lebenshaltungskosten, muss auch die Freigrenze angehoben werden. Für unterhaltspflichtige Personen – also beispielsweise Eltern mit Nachwuchs im Kindesalter – gelten höhere, gestaffelte Freigrenzen.
Pfändungsschutzkonto
Nach einer eineinhalbjährigen Übergangsphase verbleibt nach dem Jahreswechsel 2011/2012 das Pfändungschutzkonto (P-Konto) als einziger Weg, um über den pfändungsfreien Betrag zu verfügen.
Jeder Bürger in Deutschland hat einen rechtlichen Anspruch darauf, eines – und nur eines – seiner Girokonten in ein P-Konto umzuwandeln. Dafür benötigt er weder einen gerichtlichen Beschluss, noch das Wohlwollen seiner Bank.
P-Konto einrichten
Wenden Sie sich an Ihre Bank, um ihr Girokonto in ein P-Konto umzuwandeln. Wenn es schnell gehen soll: am besten persönlich in einer Filiale. Eine Umwandlung bedarf einer Änderung ihres Vertrages mit der Bank. Deshalb ist eine Unterschrift notwenig.
Wer unterhaltspflichtig ist und wem daher ein höherer pfändungsfreier Betrag als der Grundfreibetrag von 1028,89 Euro zusteht, benötigt dafür gegenüber der Bank in der Regel eine Bescheinigung. Eine Schuldnerberatung kann helfen, hier die nötigen Unterlagen zusammenzustellen.
Keine Kontosperrung
Wessen Girokonto gepfändet wurde und wer es deshalb in ein P-Konto umwandeln möchte, kann und sollte von der Bank verlangen, dies innerhalb von höchstens drei Geschäftstagen zu erledigen. Ab dem vierten Tag hat der Kunde Anspruch auf die Funktionen des Pfändungsschutzkontos.
Der P-Konto-Inhaber kann auf diesem Konto selbst dann über seinen monatlichen pfändungsfreien Betrag verfügen und Überweisungen tätigen, wenn eine Pfändung vorliegt. Das P-Konto wird nicht gesperrt.
Haken beim P-Konto

Mit Pfändungen belastete Kunden gehören für seriöse Banken zumeist nicht zur Zielgruppe. Wer sein Girokonto in ein P-Konto umwandeln möchte, wird daher damit rechnen müssen, dass die Bedingungen weniger vorteilhaft als bei anderen Kontomodellen sind.
Leider gehen manche Geldinstitute auch soweit, ihre Kunden über das P-Konto eindeutig falsch zu informieren, sie unfreundlich zu behandeln oder horrende Zusatzgebühren zu verlangen.
Kosten
Insbesondere höhere Kosten für den Pfändungsschutz dürften Kunden gemäß höchstrichterlicher Rechtssprechung eigentlich nicht entstehen. Allerdings hat der Gesetzgeber bei Einführung des P-Kontos verpasst, hier unmissverständliche Regelungen ins Gesetz zu schreiben. Unsere Petition an den Bundestag dazu blieb ohne entsprechende Resonanz.
So nutzen manche Banken die Einführung des P-Kontos, um ihre finanzschwachen Kunden besonders zu schröpfen, bis neue Gerichtsentscheidungen zum P-Konto rechtskräftig sind. Betroffene können sich gegebenenfalls an Verbraucherzentrale und Schuldnerberatung wenden. Eine Beschwerde beim Ombudsmann des zuständigen Bankenverbandes kann ebenfalls sinnvoll sein.
Bildmaterial: free-clipart.net